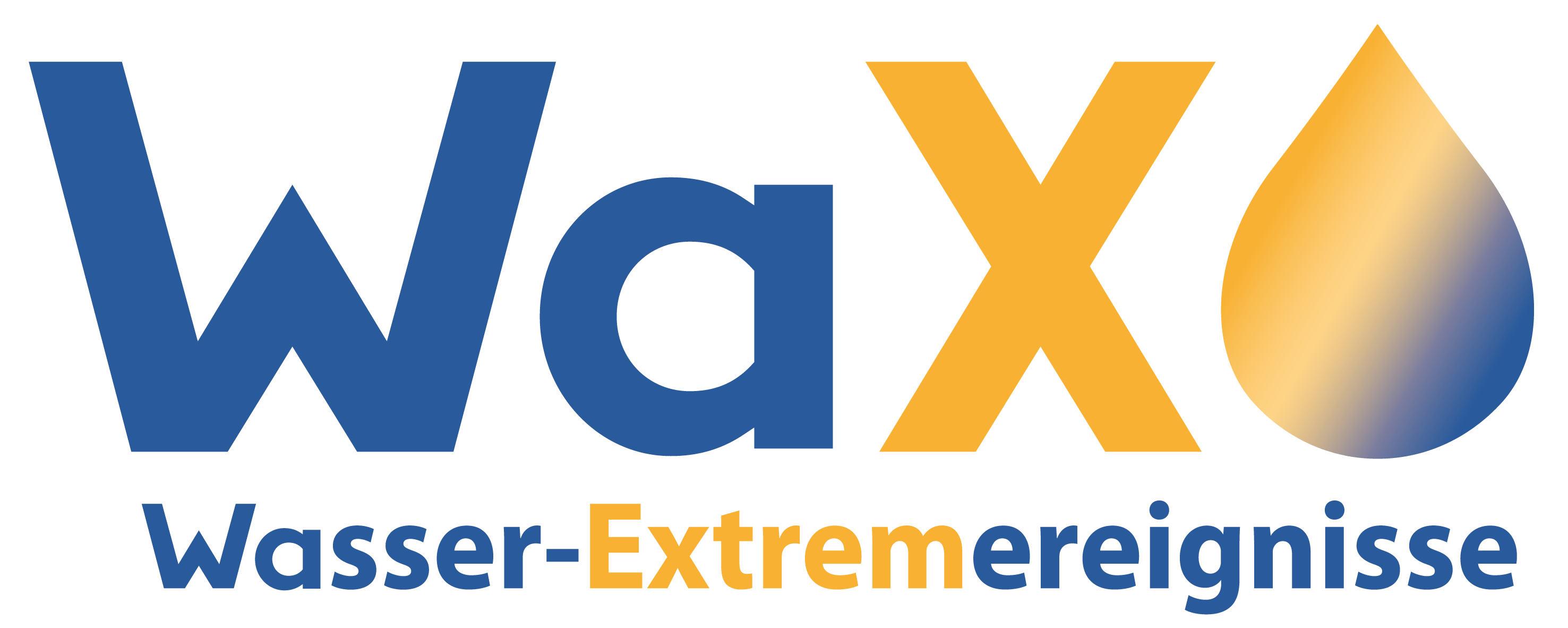Nach rund drei Jahren Laufzeit fand am 12. und 13. März 2025 die Abschlusskonferenz der Fördermaßnahme Wasser-Extremereignisse, kurz WaX, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Berlin statt. Seit Februar 2022 forschen in WaX zwölf Verbünde mit insgesamt 81 Partnerinstitutionen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis an Ansätzen, um die negativen Auswirkungen von Dürreperioden, Starkregen- und Hochwasserereignissen zu verringern und neue Perspektiven für die Wasserwirtschaft zu eröffnen.
Mehr als 200 Teilnehmende aus den Forschungsprojekten sowie Interessierte aus Fachöffentlichkeit, Politik und Praxis kamen in Berlin zusammen, um die gewonnenen Erkenntnisse zu diskutieren. BMBF-Staatssekretär Dr. Karl Eugen-Huthmacher eröffnete die Konferenz. Er betonte die Dringlichkeit innovativer Lösungen angesichts jüngster Extremereignisse wie Sturzfluten in Valencia, Dürre in Kalifornien und Hangrutschungen in Norditalien. „Unsere Wasserinfrastrukturen sind nicht für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet. Innovative Lösungen – zum Beispiel solche, wie sie in den 12 WaX-Projekten erzielt wurden – müssen in Pilotprojekten und Reallaboren hochskaliert, erprobt und anschließend auch in der Fläche umgesetzt werden“, erklärte Huthmacher.
Innovative Forschung für die Wasserwirtschaft
Im Anschluss präsentierten die zwölf Forschungsprojekte ihre wichtigsten Ergebnisse. Dabei wurden zentrale Themen wie Vorhersage, nachhaltige Wasserinfrastruktur, insbesondere im urbanen Raum, und das Risikomanagement gegensätzlicher hydrologischer Extreme behandelt. Am Markt der Möglichkeiten konnten die Teilnehmenden die entwickelten Tools und Methoden nicht nur kennenlernen, sondern auch direkt testen und an Postern mit Expert:innen diskutieren.
Präzisere Vorhersagen für Starkregen, Sturzfluten und Trockenheit
- Innovative Verfahren können die Genauigkeit der Vorhersage von Starkregen verbessern. Um das tatsächlich abfließende Wasser besser zu prognostizieren, wurde ein Sturzflutindex entwickelt, der auch Gelände- und Bodeneigenschaften berücksichtigt. Genauso zentral ist eine gute Risikokommunikation, die die Bevölkerung einbindet. Am Markt der Möglichkeiten konnten die Teilnehmenden dafür z.B. eine VR-Brille testen, die virtuell ein Hochwasserereignis erleben lässt.
- Neben Starkregen und Sturzfluten stellt auch die zunehmende Trockenheit eine wachsende Herausforderung dar. Ein nutzerspezifisches Frühwarnsystem für Dürre sowie ein Dürre-Monitoring sollen insbesondere der Land- und Forstwirtschaft helfen, frühzeitig Maßnahmen zur Schadensminderung zu ergreifen. Eine Niedrigwasseranalyse unterstützt dabei, die Folgen von Niedrigwasser in Flüssen objektiv zu bewerten und Maßnahmen auszuwählen. Gleichzeitig wurden Werkzeuge entwickelt, um die öffentliche Trinkwasserversorgung besser an Extreme anzupassen.
Wasserextreme im urbanen Raum
- Städte sind besonders stark von Wasserextremen betroffen. Um Kommunen dabei zu unterstützen, geeignete Maßnahmen auszuwählen, wurde ein webbasiertes Planungstool entwickelt. Es ermöglicht, passende Kombinationen aus blau-grüner Infrastruktur – wie erweiterte Gründächer oder Baumrigolen – gezielt auszuwählen. Teilnehmende der Konferenz konnten das Tool am Markt der Möglichkeiten direkt an einem digitalen Planungstisch ausprobieren.
- In der Stadtentwässerung greifen verschiedene Komponenten, u.a. auch das Kanalnetz, ineinander. Für ein ganzheitlich und sektorübergreifendes Management von Wasserextremen wurde ein digitaler Zwilling der Stadtentwässerung Hannover entwickelt.
- Weitere Forschungsergebnisse umfassen präzisere Methoden zur Ausweisung von Notabflusswegen sowie eine KI-gestützte Steuerung des Kanalnetzes.
Risikomanagement gegensätzlicher hydrologischer Extreme
- Um langfristig einen Ausgleich zwischen zu viel und zu wenig Wasser in der Landschaft zu fördern, wurde das Potenzial verschiedener naturbasierter, aber auch technischer Maßnahmen zur Verbesserung eines nachhaltigen Landschaftswasserhaushalts untersucht.
- Smarte multifunktionelle Wasserspeicher ermöglichen es, Wasserrückhaltemaßnahmen technisch so zu erweitern, dass überschüssiges Wasser nach einer Aufbereitung in den Grundwasserleiter infiltriert und dort gespeichert werden kann. So können Schäden durch Hochwasser reduziert und gleichzeitig die Auswirkungen von Trockenheit abgemildert werden.
Von der Forschung in die Praxis: Zukunftsperspektiven
In übergreifenden Diskussionen stand die Übertragbarkeit der Lösungen im Fokus. Wie lassen sich die Erkenntnisse in die Praxis umsetzen, wo bestehen noch Herausforderungen? Aus Forschungsperspektive wurde betont, dass viele der an Pilotstandorten entwickelten Methoden grundsätzlich auf andere Standorte übertragbar sind – auch wenn die Ergebnisse nicht eins zu eins übernommen werden können. Entscheidend ist dabei, dass ausreichende Daten verfügbar sind. Beteiligte Anwender:innen betonten, Anpassung an Wasserextreme als Prozess zu betrachten, der bis zur Umsetzung kontinuierlich begleitet werden muss. Die Verantwortung für die Umsetzung liegt letztlich bei den zuständigen Verwaltungen. Es gilt mutige Entscheidungen zu treffen und auf Basis bestehender Strukturen neue Wege zu beschreiten, z.B. im Rahmen der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Beim Thema Risikokommunikation wurde über den Umgang mit Unsicherheiten diskutiert. Während eine lokal präzise Vorhersage von Starkregen für die nächsten 12 Stunden aktuell nicht möglich ist, können Vorhersagen und Warnungen für wenige Stunden deutlich verbessert werden. So können gefährdete Stadtbezirke, z.B. basierend auf Niederschlags-Schwellenwerten, rechtzeitig ausgewiesen und vulnerable Bereiche geräumt werden.
Neben dem BMBF war auch das Bundesumweltministerium vertreten. Regina Paas (BMUV) ordnete WaX in die Nationale Wasserstrategie ein und stellte die zahlreichen Synergien, z.B. in den Themenbereichen Schwammstadt und Wasserhaushalt, in den Vordergrund. Den Abschluss bildete eine Podiumsdiskussion zum Thema „Anpassung an Wasserextreme – Zwischen Chancen und Grenzen“, die mit einem Impulsvortrag von Prof. Dr.-Ing. Jörg Drewes (TU München) eröffnet wurde. Er stellte zentrale Erkenntnisse aus dem aktuellen WBGU-Gutachten „Wasser in einer aufgeheizten Welt“ vor und betonte die Dringlichkeit eines sektorübergreifenden Wassermanagements. In der anschließenden Diskussion mit Dr. Rainer Müssner (BMBF), Dr. Franziska Meinzinger (HAMBURG Wasser) und Regina Paas (BMUV) wurde hervorgehoben, dass wissenschaftliche Erkenntnisse praxistauglich aufbereitet und langfristig zugänglich gemacht werden müssen. Zudem wurde die Notwendigkeit betont, bestehende Strukturen flexibler zu nutzen, um Anpassungsmaßnahmen schneller umzusetzen, und Forschung, Praxis sowie Politik enger zu vernetzen.
Die Konferenz bot nicht nur wissenschaftliche Einblicke, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zum fachlichen und informellen Austausch. Besonders wertvoll war der direkte Dialog mit Expert:innen am Markt der Möglichkeiten sowie die zahlreichen informellen Gespräche, die sich während Kaffeepausen und in musikalischer Begleitung am Abendempfang ergaben. Die starke Beteiligung aus der Praxis – auch von Interessierten außerhalb der Fördermaßnahme – unterstreicht das große Interesse an den WaX-Ergebnissen und deren Anwendung. Viele neue Synergien konnten geschaffen, Anknüpfungspunkte identifiziert und Impulse für künftige Zusammenarbeit gesetzt werden.
Die Tagungsbroschüre, das Programm sowie die Präsentationen und Poster der Veranstaltung finden Sie hier: WaX-Abschlusskonferenz: Ergebnisse aus drei Jahren Forschung zum Umgang mit Wasserextremen – BMBF WAX